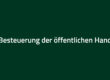Beihilfeprüfung und steuerrechtliche Gemeinnützigkeit von Servicekörperschaften
Mit Beschluss V R 22/23 vom 22.5.2025 hat der BFH dem EuGH drei Vorlagefragen zur Auslegung von Art. 107 und Art. 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (AEUV) vorgelegt. Gegenstand des Verfahrens sind die im nationalen Steuerecht geregelten gemeinnützigkeitsbezogenen Steuerbegünstigungen und ihre Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht.
Sachverhalt:
Im Februar 2022 wurde eine GmbH – die Klägerin – gegründet, deren einziger Geschäftszweck darin bestand, Finanzbuchhaltungs- und Rechnungswesensdienstleistungen gegen Vergütung für eine gemeinnützige Stiftung zu erbringen. Diese Leistungen wurden zuvor von einem externen Dienstleister übernommen. Die GmbH hat im Sinne des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts einen entsprechenden Gesellschaftsvertrag erhalten und beabsichtigt, ihren Satzungszweck durch planmäßige Zusammenarbeit mit der steuerbegünstigten Stiftung zu verwirklichen, obwohl die Stiftungssatzung keinerlei ausdrücklichen Hinweis auf eine solche Kooperation enthielt.
Das Finanzamt stellte nach § 60a Abs. 1 AO zunächst formell fest, dass der Gesellschaftsvertrag der GmbH den Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts genügt; kurz darauf hob es diese Entscheidung jedoch auf, weil es eine interne Verwaltungsvorschrift zu § 57 Abs. 3 AO dahin verstand, dass ein sogenanntes doppeltes Satzungserfordernis gelte: In den Statuten beider Beteiligter müssten sowohl die kooperierende Körperschaft als auch die Art der Zusammenarbeit ausdrücklich erwähnt sein. Dies Anforderung sei in der Stiftungssatzung nicht erfüllt gewesen. Der anschließenden Klage gab das Finanzgericht (FG) statt und sah die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit als erfüllt an.
Nach Auffassung des Gerichts enthält § 57 Abs. 3 AO weder nach seinem Wortlaut noch seinem Sinn und Zweck ein doppeltes Satzungserfordernis. Eine ausdrückliche Verankerung der Kooperation in der Stiftungssatzung erachtete es daher als entbehrlich. Darüber hinaus handele es sich bei der Regelung unionsrechtlich lediglich um eine unbeachtliche Änderung einer „Altbeihilfe“. Die Vorschrift erleichtere allein die Zusammenarbeit bereits steuerbegünstigter Körperschaften und die Auslagerung von Serviceleistungen, ohne den Umfang der steuerlichen Begünstigung zu erweitern.
Gegen dieses Urteil legte das Finanzamt Revision ein und rügte die Verletzung materiellen Rechts. Auf Rückfrage teilte das Bundesministerium der Finanzen im Revisionsverfahren mit, dass keine Notifizierung durch die EU-Kommission stattgefunden habe. Denn eine Notifizierung sei nicht erforderlich gewesen, weil gemeinnützige Unternehmen nicht mit marktüblichen Unternehmen vergleichbar seien und die Präzisierung durch § 57 Abs. 3 AO keine Erweiterung des bestehenden Gemeinnützigkeitskonzepts darstelle, sondern dessen Umsetzung lediglich konkretisiere.
Entscheidungsgründe:
Der BFH hat die Rechtsfrage zwar nicht abschließend entschieden, lässt aber in den Beschlussgründen erkennen, dass die Revision des Finanzamtes keinen Erfolg hätte, wenn § 57 Abs. 3 AO weder eine Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV begründet noch über eine zulässige unwesentliche Änderung einer bestehenden Beihilfe hinausgeht. In diesem Fall wäredie Entscheidung des Finanzgerichts zutreffend und die Revision unbegründet. Ein doppeltes Satzungserfordernis verneint der BFH damit.
Gleichzeitig erkennt der BFH jedoch, dass die Ausweitung des Begünstigungskreises durch § 57 Abs.3 AO potenziell Wettbewerbsverzerrungen im Nachfragemarkt zur Folge haben kann. Um zu klären, ob und in welchem Umfang dadurch EU-Recht berührt ist, setzte der BFH das Verfahrenaus und legte dem EuGH drei Vorabentscheidungsfragen vor.
In diesem Zusammenhang möchte der BFH zunächst klären lassen, ob die in § 57 Abs. 3 AO eingeräumte Steuerbegünstigung für Servicekörperschaften beim Erbringen wirtschaftlicher Leistungen an andere gemeinnützige Träger als selektiver Vorteil zu qualifizieren ist. In dieser gezielten Ausweitung sieht der BFH einen möglichen staatlichen Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig soll geprüft werden, ob die gemeinnützigkeitsrechtlichen Beschränkungen – insbesondere die enge Mittelverwendung und Vermögensbindung – den selektiven Vorteil soweit relativieren, dass der Tatbestand einer Beihilfe entfällt. Schließlich richtet sich die dritte Vorlagefrage darauf, ob die durch § 57 Abs. 3 AO bewirkte Ausweitung des Kreises steuerbegünstigter Zweckbetriebe im Vergleich zur historischen Regelung als „Umgestaltung“ einer Altbeihilfe im Sinne von Art. 108 Abs. 3 AEUV zu werten und somit notifikationspflichtig wäre. Denn der Gesetzgeber hat durch § 57 Abs. 3 AO die mittelbare Zweckverwirklichung mit der unmittelbaren Zweckverwirklichung gleichgesetzt.
Die finalen Vorlagefragen lauten:
1. Ist Art. 107 Abs. 1 AEUV dahingehend auszulegen, dass eine unter diese Vorschrift fallende staatliche Beihilfe vorliegt, wenn einer Körperschaft nach einer nationalen Regelung für eine wirtschaftliche Tätigkeit die Steuerbegünstigung eines Zweckbetriebs auch dann zusteht, wenn sie ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke nicht unmittelbar selbst zu verwirklichen hat, sondern diese Zwecke satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft verfolgen kann, so dass sie als Servicekörperschaft an diese andere Körperschaft steuerbegünstigt Leistungen jeglicher Art im Wettbewerb zu nicht steuerbegünstigten Leistungsanbietern erbringen kann?
2. Steht es dem hierfür erforderlichen selektiven Vorteil entgegen, dass die Servicekörperschaft gemeinnützigkeitsrechtlichen Beschränkungen insbesondere im Hinblick auf Mittelverwendung und Vermögensbindung unterliegt?
3. Bei Bejahung der Beihilfe: Ist Art. 108 Abs. 3 AEUV dahingehend auszulegen, dass eine dieser Vorschrift unterliegende Umgestaltung einer Beihilfe vorliegt, wenn das nationale Recht zwar
bereits vor dem 1.1.1958 eine Steuerbegünstigung für wirtschaftliche Tätigkeiten als Zweckbetrieb vorsah, der Anwendungsbereich dieser Steuerbegünstigung aber danach in der Weise erweitert wurde, dass eine Servicekörperschaft an andere steuerbegünstige Körperschaften steuerbegünstigt Leistungen jeglicher Art im Wettbewerb zu nicht steuerbegünstigten Leistungsanbietern erbringen kann?
Praxishinweis
Der Vorlagebeschluss an den EuGH wird bei allen, die im gemeinnützigkeitsrechtlichen Umfeld agieren, für erhebliche Verunsicherung sorgen. Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurde in § 57 Abs. 3 AO eine neue Detailregelung geschaffen, deren Beihilfencharakter nun erstmalig zur Debatte steht. Entscheidet der EuGH, dass § 57 Abs. 3 AO eine neue, wettbewerbsverzerrendeBeihilfe darstellt, dürfte die Vorschrift künftig nicht mehr anwendbar sein. Servicekörperschaften – wie die Klägerin – würden damit ihren Status als steuerbegünstigte Gemeinnützigkeit verlieren. Nach Auffassung des BFH führt die reine Ausgliederung von Tätigkeiten, die bislang im ideellen Bereich oder in einem Zweckbetrieb ausgeübt wurden, auf einen neuen Rechtsträger nicht zu einer Erweiterung der Steuerbegünstigung. Da § 57 Abs. 3 AO jedoch auch die Gründung zusätzlicher Servicekörperschaften umfasst, sieht der BFH hierin keine bloß unwesentliche, beihilferechtlich irrelevante Änderung. Deshalb qualifiziert er § 57 Abs. 3 AO als wesentliche Änderung einer Altbeihilfe, weil nun auch Neugründungen im Kooperationsverbund steuerlich begünstigt werden.